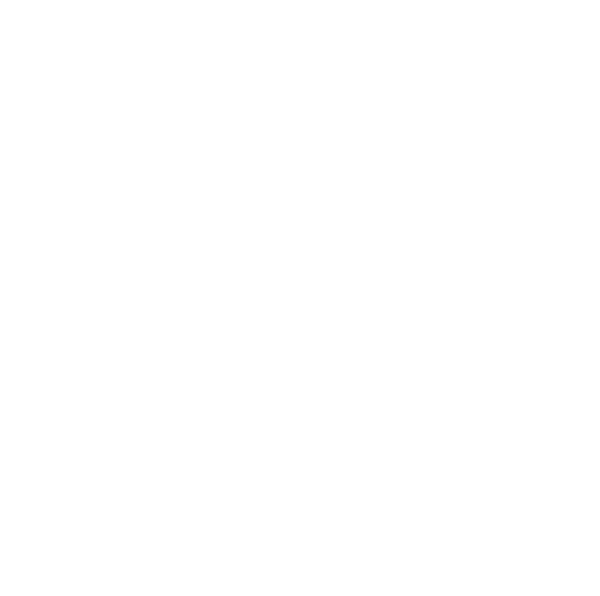Fakten statt populistische Behauptungen – Luzern braucht eine verlässliche Spitalstrategie, keine Rückschritte
Die pauschale Kritik am revidierten Spitalgesetz des Kantons Luzern ist nicht nur unbegründet, sondern gefährlich kurzsichtig. Wer behauptet, das Gesetz führe zu einer Überversorgung, treibe die Kosten unnötig in die Höhe und sei reine Symbolpolitik, ignoriert wesentliche Fakten und damit auch die Realität der gesundheitspolitischen Herausforderungen in unserem Kanton.
Die Wahrheit ist, der Kanton Luzern hat weder eine Überversorgung noch zu viele Spitalbetten. Diese Frage wurde im Planungsbericht zur Gesundheitsversorgung mit fundierten Daten akribisch untersucht. Der Bericht kommt klar zum Schluss: Die geplante Struktur, mit den Standorten Sursee und Wolhusen, entspricht dem realen medizinischen Bedarf. Das Parlament hat den Bericht einstimmig gutgeheissen, weil er eine sachliche und tragfähige Grundlage für die Gesetzesrevision bietet.
Wer diesen Bericht ignoriert oder infrage stellt, verweigert sich nicht nur den belegbaren Fakten, sondern auch einem breit getragenen politischen Konsens. Besonders problematisch ist die Behauptung, die gesetzlich verankerte Standortbindung sei ein starres Korsett. In Wahrheit ist sie ein bewusst gesetzter Rahmen, der sicherstellt, dass nicht rein betriebswirtschaftliche Überlegungen über die medizinische Versorgung entscheiden.
Spitäler sind keine normalen Unternehmen, sie sind Teil der öffentlichen Grundversorgung. Wer die unternehmerische Freiheit des Luzerner Kantonsspitals über das Wohl der Bevölkerung stellt, verkennt den Kernauftrag eines öffentlichen Spitals: eine verlässliche Versorgung, gute Erreichbarkeit und Verantwortung gegenüber allen Regionen – nicht nur den städtischen Gebieten. Das Spital Wolhusen ist kein „politisches Prestigeprojekt“, wie gerne suggeriert wird. Sie ist ein elementarer Teil einer flächendeckenden und solidarischen Spitalstrategie, die auch ländliche Regionen nicht abhängt.
Gerade im Kontext des demografischen Wandels und des zunehmenden Fachkräftemangels ist es falsch, Strukturen aus rein finanziellen Überlegungen herauszubrechen, bevor nachhaltige Alternativen bereitstehen. Eine „Flexibilisierung“, wie von Kritikern gefordert, bedeutet im Klartext: Rückzug, Abbau und Zentralisierung, was zuerst jene trifft, die ohnehin schon längere Wege und eine schlechtere Anbindung haben.
Auch das Argument steigender Kosten greift zu kurz. Eine durchdachte Grundversorgung in der Fläche kann langfristig Folgekosten reduzieren etwa durch frühzeitige Behandlungen, geringere Notfallbelastung oder kürzere Verlegungswege. Wer hingegen Lücken in der Versorgung in Kauf nimmt, spart vielleicht kurzfristig, verursacht aber auf Dauer höhere Belastungen für das gesamte System.
Interkantonale Zusammenarbeit, wie sie als Alternative ins Spiel gebracht wird, ist sicher wichtig, aber sie ersetzt nicht die Verantwortung des eigenen Kantons. Vernetzung darf nicht zum Vorwand werden, sich aus der regionalen Verantwortung zu stehlen. Ein stabiles und eigenständiges Gesundheitsnetz ist kein Widerspruch zu Kooperation, sondern deren Grundlage.
Kurz gesagt: Das neue Gesetz bringt Planungssicherheit, stärkt die wohnortnahe Versorgung und schützt vor willkürlichem Leistungsabbau – ein vorausschauender Schritt im Sinne der Bevölkerung. Wer dieses Vorhaben diskreditiert, führt ideologisch gefärbte Scheindebatten auf dem Rücken der Allgemeinheit.
Fakten statt populistische Behauptungen – Luzern braucht jetzt eine bedarfsgerechte Gesundheitsstrategie, die auf Verlässlichkeit, Gerechtigkeit und Weitsicht baut und nicht auf marktorientierten Schnellschüssen.